
Warum sorgt die Gürtelrose eigentlich für so viele Gerüchte, Verwirrung und offene Fragen? Wir finden, dass es an der Zeit ist, Licht ins Dunkel zu bringen und dabei auch der häufig gestellten Frage nachzugehen: „Ist die Gürtelrose ansteckend?“ Darüber hinaus möchten wir beleuchten, welche Personengruppen besonders gefährdet sein könnten und wie man dem Risiko aktiv entgegenwirken kann. Deshalb klären wir in diesem Artikel nicht nur über mögliche Übertragungswege auf, sondern geben Dir außerdem hilfreiche Tipps, wie die Gürtelrose nachhaltig behandelt und langfristig eingedämmt werden kann.
Inhalt
Zum Verständnis vorweg: Was ist genau eine Gürtelrose?
Gürtelrose, medizinisch bekannt als Herpes Zoster, ist eine schmerzhafte Viruserkrankung, die durch das Varicella-Zoster-Virus (VZV) verursacht wird. Dieses Virus ist dasselbe, das auch für Windpocken verantwortlich ist. Nach einer durchgemachten Windpockeninfektion bleibt das Virus im Körper, genauer gesagt in den Nervenzellen, in einem inaktiven Zustand. In manchen Fällen kann es jedoch Jahre später reaktiviert werden und führt dann zur Erkrankung mit Gürtelrose.
Typische Symptome der Gürtelrose sind ein äußerst schmerzhafter Hautausschlag, der sich oft wie ein Streifen oder Gürtel auf einer Körperseite manifestiert. Diese Ausschläge entwickeln sich in der Regel zu mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen, die jucken und brennen. Neben den Hautveränderungen können auch Fieber und ein allgemeines Unwohlsein auftreten, was die Erkrankung besonders belastend macht.
Der Zusammenhang zwischen Windpocken und Gürtelrose ist ein gutes Beispiel dafür, wie Viren im menschlichen Körper oft über Jahre hinweg „schlummern“ können, um dann unter bestimmten Umständen wieder aktiv zu werden. Diese Reaktivierung ist häufig mit einem aus der Balance geratenen Immunsystem verbunden, sei es durch Alter, Stress oder bestimmte Krankheiten. Es ist also von entscheidender Bedeutung, das Immunsystem in einer gesunden Balance – in der sogenannten Immunhomöostase – zu halten, um das Risiko einer Gürtelrose zu minimieren.
Ansteckungsmechanismus: Was passiert wirklich?
Die Frage, ob und wie Gürtelrose ansteckend ist, führt oft zu Unsicherheiten. Grundsätzlich ist es entscheidend zu verstehen, dass Gürtelrose selbst nicht direkt von Person zu Person übertragen wird. Das zugrunde liegende Varicella-Zoster-Virus kann jedoch von jemandem mit aktiver Gürtelrose auf eine nicht-immune Person, also jemanden, der niemals Windpocken hatte, übertragen werden. Dies führt dann zur Entstehung von Windpocken, denn die Erstinfektion mit dem Varizella-Zoster-Virus äußert sich immer mit Windpocken. Die Gürtelrose ist immer eine Reaktivierung des bereits im Körper schlummernden Virus.
Der Übertragungsweg des Virus erfolgt hauptsächlich durch direkten Kontakt mit den Flüssigkeitsbläschen, die sich während eines Gürtelrose-Ausbruchs auf der Haut bilden. Diese Bläschen enthalten das Virus in hoher Konzentration, weshalb die Ansteckungsgefahr groß ist, solange die Bläschen nässen. Sobald die Bläschen verkrusten, nimmt das Risiko einer Virusübertragung deutlich ab – es verschwindet jedoch nicht komplett!
Es gibt bestimmte Bedingungen, die eine Übertragung begünstigen können. Dazu gehört der direkte Hautkontakt mit der betroffenen Stelle, insbesondere wenn diese nicht abgedeckt ist. Der Kontakt mit Gegenständen, die direkt mit den Bläschen in Berührung gekommen sind, wie Handtücher oder Kleidung, kann ebenfalls ein Risiko darstellen, vor allem bei immungeschwächten Personen.
Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sind Vorsichtsmaßnahmen unerlässlich. Dazu gehören das sorgfältige Abdecken des Ausschlags mit einem sauberen Verband, das Vermeiden des Kratzens an der betroffenen Stelle und eine gründliche Handhygiene. Darüber hinaus sollten enge und direkte Kontakte, insbesondere mit gefährdeten Personen wie Schwangeren, Neugeborenen oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, vermieden werden.
>Durch ein fundiertes Verständnis des Ansteckungsmechanismus und die Einhaltung angemessener Hygienemaßnahmen kannst Du dazu beitragen, die Verbreitung des Varicella-Zoster-Virus zu verhindern und das Risiko einer Übertragung auf andere zu reduzieren.

Gürtelrose ansteckend? Die Rolle des Immunsystems
Ein gesundes Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie gegen viele Krankheiten, einschließlich der Gürtelrose. Das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Varicella-Zoster-Virus in Schach zu halten, sobald es nach einer Windpockeninfektion in die Ruhephase übergegangen ist. Wenn das Immunsystem jedoch angeschlagen ist, besteht die Gefahr, dass das Virus reaktiviert wird und es zu einem Ausbruch der Gürtelrose kommt.
Ein gesundes Immunsystem kann hingegen die Häufigkeit und Schwere von Gürtelrose-Ausbrüchen erheblich reduzieren. Wenn das Immunsystem ausgeglichen und reaktionsfähig ist, kann es die Anzahl der Viren niedrig halten und verhindern, dass sie erneut aktiv werden und Symptome auslösen.
Faktoren, die das Immunsystem negativ beeinträchtigen können, sind vielfältig. Zu den häufigsten zählen Stress, ungesunde Lebensgewohnheiten (wie unzureichende Ernährung und Bewegungsmangel), chronische Krankheiten, bestimmte Medikamente (insbesondere immunsuppressive Mittel) und das natürliche Altern, das mit einem schwächer werdenden Immunsystem einhergeht. All diese Faktoren können die Immunantwort beeinträchtigen und das Risiko für stärker ausgeprägte und häufigere Ausbrüche erhöhen.
In Bezug auf die Ansteckungsgefahr spielt ein gesundes Immunsystem ebenfalls eine wesentliche Rolle: Es kann dazu beitragen, das Virus effektiv zu bekämpfen und so die Viruslast zu reduzieren, was wiederum das Risiko verringern kann, das Virus auf andere zu übertragen.
Wie kann Gürtelrose behandelt werden?
Üblicherweise beinhaltet die schulmedizinische Therapie von Herpes Zoster eine symptomatische Behandlung mit Schmerzmitteln und antiseptischen Lösungen zur Anwendung auf den betroffenen Hautstellen sowie die Verabreichung von Virustatika zur Verhinderung von Komplikationen und Langzeitfolgen. Während die schulmedizinischen Behandlungen vor allem die Symptome lindern, kann die Mikroimmuntherapie verwendet werden, um die Ursachen der Erkrankung in den Griff zu bekommen. Die Mikroimmuntherapie setzt auf zwei Ebenen an: Sie unterstützt einerseits das Immunsystem in der Virenabwehr und sie zielt darauf, die Virusvermehrung selbst zu unterbinden.
In der Mikroimmuntherapie werden unter anderem Substanzen verwendet, die bereits in unserem Körper vorkommen – wie die Immunbotenstoffe oder auch Zytokine, die zur Regulierung unserer Immunreaktionen sehr wichtig sind. So soll das Immunsystem bei der Bekämpfung der Varizella-Zoster-Viren sanft unterstützt werden, mit dem Ziel, Neuinfektionen weiterer Zellen zu verhindern. Spezifische Nukleinsäuren zielen zudem darauf ab, die Replikation der Viren zu unterbinden. Mikroimmuntherapeuten sammeln hervorragende Erfahrungen in der Behandlung der Gürtelrose, da die Krankheit mit der Hilfe der Mikroimmuntherapie schneller abheilen und insbesondere der gefürchteten Post-Zoster-Neuralgie effektiv entgegengewirkt werden kann. Dabei ist es für den Behandlungserfolg wichtig, so früh wie möglich mit der Behandlung zu beginnen.
Die postzosterische Neuralgie beschreibt Schmerzen, die nach dem Abklingen der akuten Infektion bestehen bleiben. Normalerweise klingen diese Schmerzen innerhalb von ein bis drei Monaten ab. Bei einer Post-Zoster-Neuralgie hingegen bleiben die Schmerzen bestehen und können chronisch werden. Für die Betroffenen entsteht dadurch ein erheblicher Leidensdruck. Die Schulmedizin steht hier häufig vor einer großen Herausforderung, da medikamentöse Methoden die Schmerzen oft nicht wie gewünscht lindern können.
Die Mikroimmuntherapie zielt bei postzosterischen Neuralgien darauf ab, reaktivierte Viren durch sanfte Immunmodulation unter Kontrolle zu bringen und Beschwerden zu lindern. Sie ergänzt die schulmedizinische Behandlung, da sie den Heilungsprozess fördert und den Körper langfristig vor Rückfällen und Langzeitfolgen schützt.
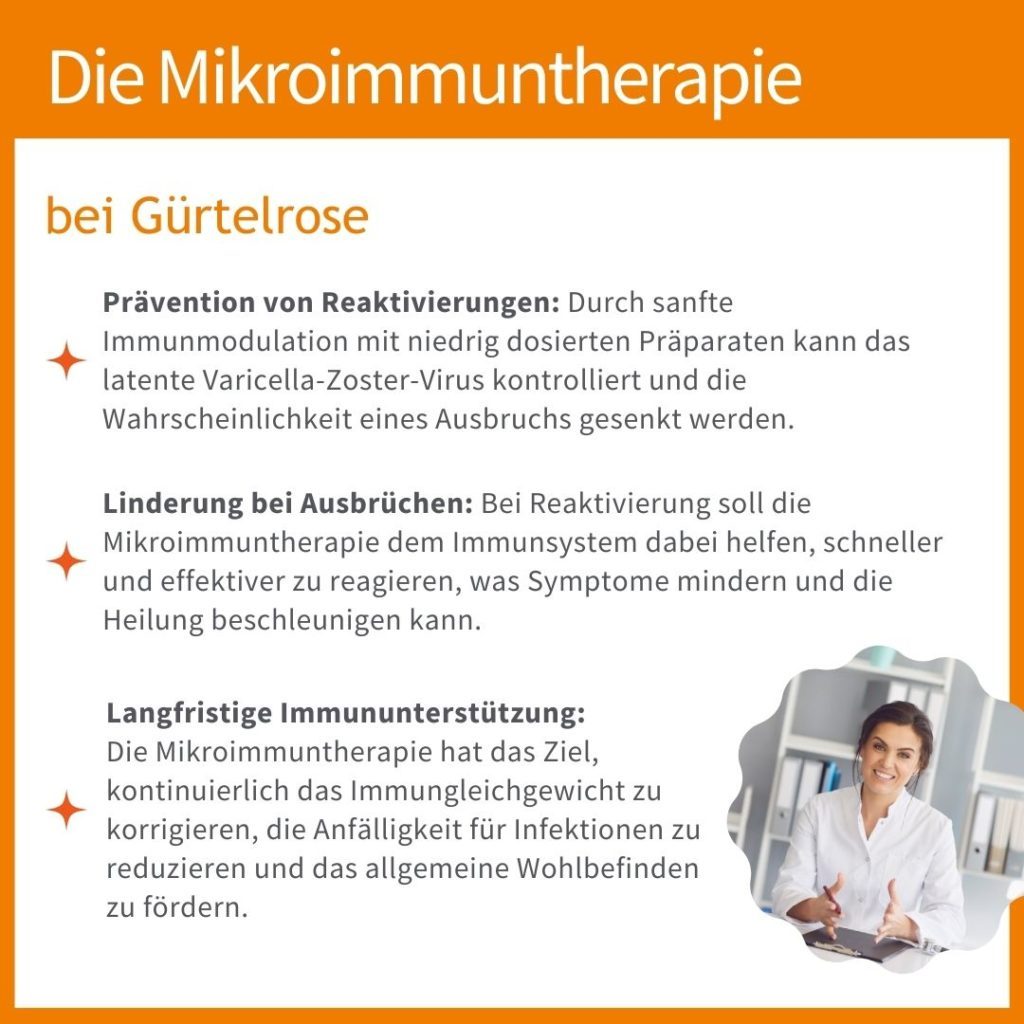
Fakten vs. Mythen: Aufklärung
Heute räumen wir mit 6 weit verbreiteten Mythen rund um die Gürtelrose auf! Hättest Du es gewusst?

Gürtelrose kann nur einmal auftreten.

Während viele Menschen nur einmal in ihrem Leben an Gürtelrose erkranken, ist es durchaus möglich, dass es zu mehreren Ausbrüchen kommt, insbesondere wenn sich das Immunsystem außer Balance befindet.

Gürtelrose tritt nur bei älteren Menschen auf.

Obwohl das Risiko mit dem Alter steigt, kann Gürtelrose Menschen jeden Alters betreffen, besonders jene mit einem ungesunden Immunsystem oder unter hohem Stress.

Gürtelrose befällt immer den Rumpf.

Gürtelrose tritt häufig entlang der Nervenbahnen am Rumpf auf, kann aber auch Gesicht, Hals oder andere Körperregionen betreffen.

Sobald die Bläschen verkrustet sind, ist man nicht mehr ansteckend.

Es stimmt, dass die Ansteckungsgefahr signifikant abnimmt, wenn die Bläschen verkrustet sind. Es ist jedoch wichtig, weiterhin Vorsicht walten zu lassen, bis alle Läsionen vollständig abgeheilt sind.

Man muss die Bläschen aufkratzen, um das Virus zu übertragen.

Bereits der Kontakt mit dem Flüssigkeitsinhalt der Bläschen kann das Virus übertragen, daher ist es wichtig, Hautkontakt zu vermeiden.

Eine Gürtelrose-Impfung gibt 100%igen Schutz.

Obwohl die Gürtelrose-Impfung das Risiko für einen Ausbruch deutlich reduziert, bietet sie keinen vollständigen Schutz. Sie kann jedoch helfen, die Schwere eines Ausbruchs zu verringern.
Was tun bei einem Ausbruch der Gürtelrose?
Ein Ausbruch der Gürtelrose kann schmerzhaft und unangenehm sein, daher ist es wichtig, schnell zu handeln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Hier sind einige Anweisungen, die bei einem Ausbruch hilfreich sein können:
- Frühe Anzeichen beachten: Sobald Du die ersten Anzeichen eines Gürtelrose-Ausbruchs wie juckende oder brennende Haut, rote Flecken oder einen Hautausschlag bemerkst, solltest Du sofort einen Arzt aufsuchen. Dies gilt besonders, wenn der Ausschlag oder die Schmerzen in der Nähe der Augen auftreten, um das Risiko schwerwiegender Komplikationen zu vermeiden.
- Achtung bei Komplikationen: Sollten Symptome wie Fieber, Verwirrtheit oder Anzeichen einer Sekundärinfektion (z.B. Eiterbildung an den Bläschen) auftreten, ist dringend medizinische Hilfe erforderlich. Diese Anzeichen können auf eine schwerwiegendere Entwicklung der Erkrankung hindeuten und erfordern sofortige Behandlung.
- Symptomverlauf beobachten: Es ist wichtig, die Symptome genau zu überwachen. Achte auf Veränderungen oder eine Verschlechterung, um rechtzeitig eingreifen zu können und mögliche Komplikationen vorzubeugen. Regelmäßige ärztliche Kontrollen können notwendig sein, um den Krankheitsverlauf zu überwachen.
- Schmerzmanagement: Bei starken Schmerzen oder Symptomen, die trotz Behandlung nicht nachlassen, kann eine gezielte Schmerztherapie notwendig sein. Ärztliches Fachpersonal kann entsprechende medikamentöse Maßnahmen einleiten, um die Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.
- Die Immunbalance im Blick behalten: Wie bereits erwähnt, ist die Immunhomöostase bei einem Ausbruch der Gürtelrose besonders elementar für den weiteren Krankheitsverlauf. Die Mikroimmuntherapie sollte sofort bei den ersten Symptomen eingesetzt werden, um den Genesungsprozess zu unterstützen.
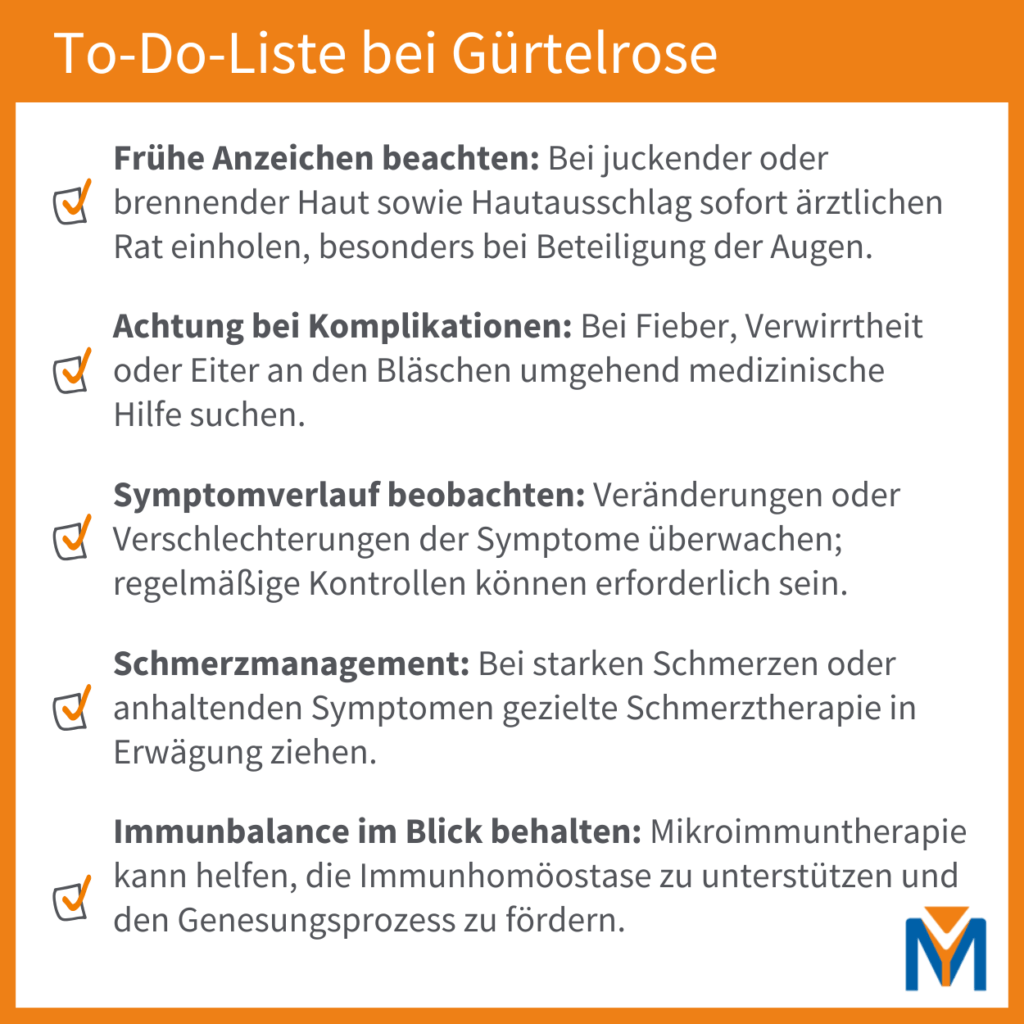
Durch schnelles Handeln und genaue Beobachtung kannst Du die Auswirkungen eines Gürtelrose-Ausbruchs reduzieren und effektiver mit der Erkrankung umgehen. Es ist wichtig, alle medizinischen Ratschläge des Arztes zu befolgen und keine Symptome zu ignorieren, um Komplikationen zu vermeiden. Und nun bist Du auch bestens darüber informiert, ob und in welchem Rahmen die Gürtelrose ansteckend sein kann.
Unser monatlicher Newsletter – immer informiert sein
Unser kostenloser Newsletter erscheint einmal pro Monat und hält Dich rund um Deine Immungesundheit auf dem aktuellen Stand. Melde Dich hier an!

Kontaktiere die MeGeMIT bei Fragen zur Mikroimmuntherapie. Bitte beachte: Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit beruhen auf den Erfahrungen der praktizierenden Mikroimmuntherapeuten.
Bild: © Canva







 Der Frühling gilt als die Jahreszeit der Verliebten: Die sogenannten Frühlingsgefühle sollen dafür sorgen, dass wir uns leichter, unbeschwerter und fröhlicher fühlen und uns sogar schneller verlieben lassen. Handelt es sich hierbei um einen Mythos oder gibt es die Frühlingsgefühle wirklich? Tatsächlich scheint sich der Hormonstatus im Frühjahr zu verändern. Durch die Sonnenstrahlen, die sich nach der dunklen Winterzeit zeigen, werden vermehrt Glückshormone ausgeschüttet. Ähnlich wie bei der Winterdepression hat das Licht also einen Einfluss auf unser Befinden – in diesem Fall jedoch in eine positive Richtung. Honeymoon Disease steht in Verbindung mit dem Verliebtsein und einem häufigen Körperkontakt, der vor allem für die frühe Phase des Verliebtseins als typisch gilt. Doch was genau bedeutet der Begriff? Wie kann die Erkrankung behandelt werden? Und wie hilft die Mikroimmuntherapie hierbei?
Der Frühling gilt als die Jahreszeit der Verliebten: Die sogenannten Frühlingsgefühle sollen dafür sorgen, dass wir uns leichter, unbeschwerter und fröhlicher fühlen und uns sogar schneller verlieben lassen. Handelt es sich hierbei um einen Mythos oder gibt es die Frühlingsgefühle wirklich? Tatsächlich scheint sich der Hormonstatus im Frühjahr zu verändern. Durch die Sonnenstrahlen, die sich nach der dunklen Winterzeit zeigen, werden vermehrt Glückshormone ausgeschüttet. Ähnlich wie bei der Winterdepression hat das Licht also einen Einfluss auf unser Befinden – in diesem Fall jedoch in eine positive Richtung. Honeymoon Disease steht in Verbindung mit dem Verliebtsein und einem häufigen Körperkontakt, der vor allem für die frühe Phase des Verliebtseins als typisch gilt. Doch was genau bedeutet der Begriff? Wie kann die Erkrankung behandelt werden? Und wie hilft die Mikroimmuntherapie hierbei?